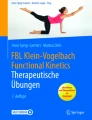Zusammenfassung
Dieser Beitrag betrachtet das Phänomen der Manipulation im Rahmen unserer zwischenmenschlichen Kommunikation und stellt die Frage nach einer ethischen Beurteilung dieser. In interdisziplinärer Weise werden zunächst die Themenkomplexe Kommunikation, Manipulation und Populismus aufgeschlüsselt und konzeptionell miteinander verschränkt. Im letzten Drittel des Beitrags widmet sich der vorliegende Essay schließlich der Frage nach der Grundlegung einer Ethik der Manipulation. Vorgeschlagen und skizziert wird eine ethische Beurteilung anhand eines minimalmoralischen Prinzips des Respekts, das uns lehrt, das Phänomen der Manipulation entgegen der klassischen ethischen Betrachtungsweisen neu zu sehen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Die Unterscheidung von „Affekten“, „Gefühlen“, „Emotionen“ und „Stimmungen“ ist nicht immer einfach – und eigentlich auch nie umstritten. Ohne in die verschiedenen Theorien einzusteigen, spreche ich hier von „Affekten“, die in ihrem ursprünglichen Wortsinn verstanden werden. Der Begriff bezeichnet also die Ebene des Menschlichen, die sich durch qualitative Regungen in Bezug auf Befinden und Erleben auszeichnet und das Handeln eines Menschen erheblich beeinflussen kann. Ich verstehe das Affektive nicht als Widerpart zur Rationalität des Menschen, sondern vielmehr als ein Bestandteil eines Ganzen, das unsere Handlungsleitung bestimmt. „Rationalität“, als die Fähigkeit von Akteuren, Gründe für eine Handlung erkennen, entwickeln und korrigieren zu können, wobei Akteure der Zweck-Mittel-Beziehung, der Logik und Nutzen- und Kostenfaktoren verpflichtet bleiben, sehe ich also in einem begrenzten Sinne am Werk (als Schlaglichter hierzu: Vietta 2012, 13, 35 ff., Gigerenzer 2008, Simon 1979).
- 2.
Diese Karriere erreichte ihren Höhepunkt im Rahmen der Wahl zum Wort des Jahres 2016 durch die Gesellschaft für deutsche Sprache und für das englische Äquivalent „post-truth“ durch die Redaktion des Oxford English Dictionaries.
- 3.
Natürlich darf man Nietzsche nicht für Trump verantwortlich machen oder glauben, dass im Weißen Haus nur Nietzsche- und Baudrillard-Jünger sitzen. Nietzsche hat nur etwas, was dort als Glaubensgrundsatz zu gelten scheint, gut formuliert und als Position vertreten. Bei Trump, Vladimir Putin und anderen scheint es eine Paarung aus der Leugnung von Wahrheiten und dem gnadenlosen Durchsetzen eigener Wahrheiten im vorher durch die Auflösung freigeräumten Feld zu geben – was die Mischung so gefährlich macht. Bernhard Pörksen hat zurecht die Trennung von dem gefordert, was „Postmoderne“ im geisteswissenschaftlichen Seminar bedeutet und dem, was im Umfeld politischer Administrationen mit einem Hang zu wahrheitsauflösenden Tendenzen, um den Raum für die eigene Ideologie zu schaffen, gemeint ist. Nicht zu übersehen ist aber, dass man all dies mit den Worten Postmoderner gut beschreiben kann, auch wenn nicht unbedingt klassische postmoderne Texte die Grundlage für das Handeln der politischen Akteure gewesen sein mag. Es seien dann, so Pörksen, das machtkritische postmoderne Denken, das sich gegen Wahrheitssetzungen verwehrt, wie auch die diskussionsbereiten Verfechter von Prinzipiellem im offenen Gespräch nötig, um diesem politischen Zustand entgegenzuwirken (vgl. Pörksen 2017).
- 4.
Bei aller Inkongruenz zwischen Faktizität und Wahrheit lässt sich nämlich sagen, dass einige Dinge näher an einer objektiven Wahrheit sind, als andere. Im Sinne einer asymptotischen Annäherung wäre die Aussage von Spicer zu den Besucherzahlen der Trump’schen Inauguration erheblich weiter von jener objektiven Wahrheit entfernt, als gegenteilige Berichte, die mittels Fernseh- und Fotoaufnahmen von oben, Zählungen im Personennahverkehr und den dann folgenden Vergleich mit anderen Amtseinführungszeremonien evidenzbasiert sind. Empirie als Methode objektiver Wahrheitsannäherung ist selbst allerdings ein umfassendes Glaubenssystem, das viel mehr als den bloßen Fakt involviert. Was damit ausgedrückt wird, ist, dass für Wahrheit ein sie selbst übersteigender Faktor eine Rolle spielt – sei es die Überzeugung der Möglichkeiten von Beobachtung, die Vernunft oder eben schlicht ein Gefühl oder Interesse – der nicht letztbegründbar ist.
- 5.
Beide Reden sind leicht auf YouTube auffindbar.
- 6.
Trumps Siegesrede wurde von der Welt positiver aufgefasst, als seine vorherige Rhetorik, da hier plötzlich versöhnlichere Töne anklingen und hochkontroverse Themen wie der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gar nicht zur Sprache kommen, sondern nur ein allgemein formulierter Neuaufbau des Landes thematisiert wird. Nichtsdestotrotz findet sich bei der Analyse der Redeinhalte ein wesentlich anders gezeichnetes Bild und eine andere Performance als noch bei Obama – dessen Siegesrede von 2008, finden sich doch zumindest leichte Parallelen, evtl. auch von Trumps Redenschreiber in den Blick genommen wurde.
- 7.
Natürlich wird in vielen Lebensbereichen manipuliert, wir richten unseren Blick hier lediglich auf die Sphäre der Politik und dort auf eine spezifische Kommunikationsstrategie.
- 8.
Hier verstanden als die Fähigkeit gemäß selbst bestimmter, vernünftiger Prinzipien freiheitlich zu handeln. Autonomie ist so selbstverständlich mehr als bloße Wahlfreiheit. Beide Komponenten, Autonomie und Wahlfreiheit, sind Bestandteil eines Freiheitsverständnisses.
- 9.
Die durchaus christlich-religiös anmutende Motivik ist offenbar. In der alten Novalis-Ausgabe, die ich nutzte, wird das Zitat den Noten zu Philosophie und Physik zugeordnet, in neueren steht es aber auch bei den Noten zur Religion.
- 10.
Wie viele andere Begriffe auch ist „Kommunikation“ einer, der in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen in vielen Varianten auftaucht und immer weiter diskutiert wird. Statt hier den Versuch einer Klärung zu unternehmen und noch einen Beitrag zur Grundlagendiskussion zu schaffen, möchte ich lediglich eine Vorstellung der Bedeutung von „Kommunikation“ einführen, die mir vielversprechend und anschlussfähig erscheint. Dabei stütze ich mich auf Konzepte im Umfeld des Weber’schen Verständnisses von „sozialem Handeln“ und die Wirkungsforschung.
- 11.
Natürlich sind diese Ebenen nicht immer sauber auseinanderzuhalten; gerade die Rhetorik, bei der hier viele Anleihen gemacht werden können, zeigt das. Ein rationales Überzeugen geht immer auch mit der Mitteilung von Informationen einher, wie sich oft auch bestimmte nonverbale Faktoren einschleichen, wenn wir argumentieren. Genauso kann ein Informationsgehalt mit nonverbalen Faktoren unterlegt werden usw. Die scharfen Trennungen haben hier also eher modellhaften Charakter.
- 12.
„Individuell“ bedeutet zwar schon, dass es vielleicht in der alltäglichen Betrachtung von Dingen (ich meine hier keinen Realismus im philosophischen Sinne) immer kleine Unterschiede bei den Beschreibungen individueller Akteure geben mag, was aber nicht bedeutet, dass jeder völlig verschiedene Versionen eines Konzerts oder Fußballspiels schildern würde – vielmehr sehen wir viele Dinge ähnlich, allein wenn wir aus ähnlichen sozialen Hintergründen stammen. Dennoch ist es im Rahmen manipulativer Kommunikationsstrategien sinnvoll, zu überlegen, wie ungefähr die Pseudo-Umwelt in den Köpfen der Empfänger aussieht – um dann auch u. U. davon abstrahieren zu können und eine möglichst breite Anschlussfähigkeit für jeden individuellen Hörer an das Kommunizierte zu schaffen.
- 13.
Natürlich lässt sich in dem hier zugrunde gelegten Modell weiter auch die Rhetorik als eine spezifische Form des Kommunizierens wittern, die sich gewissermaßen Abkürzungen in der menschlichen Kommunikation zunutze macht (sie kann so als eine Art lebensweltlich operierender Rationalität verstanden werden) und para- und nonverbale Faktoren integriert. Man denke nur an Aristoteles’ Zutatenliste für eine maximal überzeugende Wirkung der Rede, die neben logos (der wohlgeformten, folgerichtigen Beweisführung) selbstverständlich pathos (also die Erweckung von Affekten beim Zuhörer und eine rednerische Getragenheit statt rationaler Trockenheit) und ethos (eine Autorität und Authentizität des Redners) enthält.
- 14.
Mein Begriff von „strategischer Kommunikation“ bezieht sich hier also nicht auf die Entscheidung über die in Kauf zu nehmenden Anstrengungen der gewählten Kommunikationsstrategien, sondern auf das Kommunikationsziel.
- 15.
Hier das Zitat von Benesch und Schmandt: „Manipulation ist zu Recht gefürchtet. Sie gilt als ein Mittel, andere Menschen in verheerender Weise zu etwas zu zwingen, was sie in dieser oder jener Form so eigentlich gar nicht wollen oder wünschen. Wir sind heute sehr viel empfindlicher solchen Zwängen gegenüber geworden. […] Es kommt [bei Manipulation] auf die verdeckte, verheimlichte, indirekte Zielsetzung an, die den Betroffenen hintergeht, die ihm etwas vormacht, um ihn um so sicherer in die Fänge zu bekommen. Somit prellt die Manipulation meist den Betroffenen, zeitigt für ihn Nachteile […]. Mit Manipulation zwingt man jemanden zu einem bestimmten Verhalten, indem sie eine Situation schafft, durch die der Betroffene nicht anders kann, als genau wie vorgesehen zu handeln. […] [Sie ist eine] psychische Fesselung.“ (1979, 7 ff.).
- 16.
Um ein Missverständnis direkt auszuschließen, muss gesagt werden, dass Täuschung, Verschleierung und negative Folgen Bestandteil von Manipulationen sein können, aber eben nicht hinreichend sind, um das Spezifische der Manipulation herauszustellen. Das Spezifische soll hier vielmehr mittels einer Konkretisierung des Mechanismus abgebildet sein.
- 17.
Christian Illies und ich nennen dieses Modell „The Pleasurable-Ends-Model of Manipulation“ (Fischer/Illies 2018).
- 18.
Natürlich ist auch dies für ein klareres Verständnis als modellhaft zu verstehen. Unsere Handlungsleitungen gehen im wirklichen Leben natürlich oft durcheinander.
- 19.
Ganz abgesehen davon, dass Täuschung und Verschleierung auch Bestandteil rationaler Überzeugung sein können, wenn bestimmte Fakten verschwiegen werden oder schlicht Falschaussagen im Spiel sind, weshalb sie sich dennoch nicht als gutes Abgrenzungskriterium eignen. Worum es mir aber geht, lässt sich vielleicht nochmal an einem Beispiel verdeutlichen: Im Vorfeld des ersten Irakkriegs gab es ein Video der Organisation Citizens for a free Kuwait, in dem eine junge Dame, die Krankenschwester gewesen sei, vor amerikanischen Kongressangehörigen grausige Erzählungen darüber zum Besten gibt, wie die irakischen Invasoren in Krankenhäusern Säuglinge sterben ließen. Dabei war sie sehr emotional und berührte so auch viele, die das Video sahen. Während die amerikanische Bevölkerung einer Intervention im Irak eigentlich sehr kritisch gegenüber stand, kam es auch mit diesem Video zur Stimmungsänderung. Die Aussagen der jungen Frau finden sich sogar in vielen offiziellen Dokumenten der damaligen US-Regierung wieder. Allerdings war alles gelogen (wenn auch nicht unglaubwürdig). Das Video wurde von einer PR-Organisation kreiert, die junge Dame war in Wirklichkeit Tochter des damaligen kuwaitischen Botschafters in den USA. Hier wurde also getäuscht, gelogen und betrogen. Was mich aber interessiert, ist nicht der Fakt der Lüge, sondern wie dieses Video es mittels der inszenierten Emotionalität schaffte, eine Stimmungsänderung bezüglich der amerikanischen Intervention zu bewirken, also diesen Zweck attraktiver zu machen – und insgesamt: zu manipulieren.
- 20.
Wie im Text bereits angedeutet, lässt sich so etwas öfter beobachten, vor allem dann, wenn von „Neoliberalismus“, „Stigmatisierung“, „Macht“, „Regime“ o. ä. gesprochen wird. Es wird hier eine Kryptonormativität etabliert, wie sie Jürgen Habermas schon Michel Foucault vorwarf, der nämlich, so Habermas, ganz klar ein moralisches Setting in seinen Arbeiten hatte, aber dieses nicht offenlegte und sogar abstritt, dass seine Arbeiten moralisch gefärbt wären. Der Mechanismus, um den es Habermas dabei geht, ist folgender: Ein Konzept wird moralisch aufgeladen, ohne dass es eine genauere Betrachtung des Konzepts gibt geschweige denn eine ethische Argumentation, die eine abschätzige Beurteilung erklären und begründen würde. Begriffe wie „Neoliberalismus“, „Macht“, „Regime“ „Stigma“, aber auch die für uns relevanten Begriffe wie „Populismus“ oder „Manipulation“ sind dann Kampfbegriffe, die ein schon von vornherein überzeugtes und sympathisierendes Publikum ansprechen, wobei es dann keiner Begründung mehr bedarf (es sind sich ja alle schon einig über die Negativität). Sie sind so eigentlich selbst nur noch rhetorische Mittel und entsprechen auch dem, was Populisten oft vorgeworfen wird, nämlich reine Emotionalisierung zum Ziel zu haben. Der richtigere Weg wäre, solche Konzepte klar zu betrachten und zu definieren, den moralischen Katalog, vor dessen Hintergrund eine Beurteilung stattfindet, offenzulegen und die im Spiel befindlichen Dinge rational zu diskutieren.
- 21.
Das Internet mit seiner Like-/Dislike-Kultur, in der eine genauere Prüfung der Sachverhalte keine starke Rolle spielt (gemäß dem Credo: „Kommt von einem/r Freund/Freundin oder hat viele Likes? – Dann muss es richtig und gut sein.“), mag hierfür übrigens ein fruchtbarer Grund sein. Vgl. hierzu auch den Beitrag von Bernd Zywietz in diesem Band.
- 22.
In ausführlicherer Form finden sich einige Gedanken dieses Abschnitts im dritten Kapitel meines Buches Manipulation. Zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung (Fischer 2017).
- 23.
Natürlich behaupte ich nicht, dass diese Kritik neu sei – sie wird nur im Beurteilungsfall der Manipulation sehr augenfällig.
- 24.
Bereits in der Antike gibt es die Diskussion um den moralischen Status der Rhetorik im Rahmen der Gegenüberstellung mit der Dialektik. Platon verabscheut in seinem Dialog Gorgias die Rhetorik gerade deswegen, weil sie eben nicht dialektisch vorgeht, also nicht die ganze Länge des Argumentwegs ausschreite, sondern Abkürzungen sucht. Mit ihm könnte man sinngemäß fragen: Warum sollte man die Rhetorik nutzen, wenn man die Dialektik haben kann? Aristoteles setzt dagegen, dass die Rhetorik nicht allzu schnell verabschiedet werden dürfe, schließlich sei sie so etwas wie eine Art lebensweltlich operierender Modus der Rationalität, der als notwendiges Element gerade auch in der Demokratie gebraucht wird – wo nicht jeder dem platonischen Ideal gemäß zum Philosophen werden kann.
- 25.
Für eine kurze Einlassung zum Thema Manipulation, Liebe und Autonomie siehe einen kleinen Online-Beitrag von mir (Fischer 2018). Sarah Buss (2005) hat einen lesenswerten Aufsatz zur Frage nach dem Gewicht der Autonomie als Begründung gegen Verführung etc. geschrieben In einigen Gedankenzügen liegen wir auf einer ähnlichen Linie.
- 26.
Also modellhaft all jener, die der Gattung Mensch zugerechnet werden, eine gewisse Individualität, grundlegende Selbstreflexions-, Selbstbestimmungs- und Freiheitsmöglichkeiten und Verantwortungsfähigkeit besitzen sowie Überzeugungen, Wünsche und Affekte. Die Diskussion über die Integration von Menschenaffen und auch geistig Versehrten lasse ich hier außen vor.
- 27.
Literatur
Anscombe, G.E.M. 1974. Moderne Moralphilosophie. In: G. Grewendorf / G. Meggle (Hrsg.). Seminar: Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp: S. 217–243.
Beauchamp, T. (2003). A Defense of the Common Morality. Kennedy Institute of Ethics Journal 13 (3), 259–274.
Benesch, W. / Schmandt W. (1979). Manipulation und wie man ihr entkommt. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
Bloomfield, L. (1961). Language. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Burkart, R. (1998). Grundlagen und Problemfelder. Umrisse einer interdisziplinären Sozialwissenschaft. Wien, Köln/Weimar: Böhlau.
Buss, S. (2005). Valuing Autonomy and Respecting Persons: Manipulation, Seduction, and the Basis of Moral Constraints. Ethics 115 (2), 195–235. https://doi.org/10.1086/426304.
Cialdini, R. (2001). Influence. Science and Practice. Boston: Allyn & Bacon.
Darwall, S. L. (1977). Two Kinds of Respect. Ethics 88 (1), 36–49.
Dubiel, H. (1986). Populismus und Aufklärung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Eco, U. (1989). Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der Massenkultur. Frankfurt a.M.: Fischer.
Elias, N. (2006). Was ist Soziologie? In: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 5. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Fischer, A. (2017). Manipulation. Zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung. Berlin: Suhrkamp.
Fischer, A. (2018). Zwischen Gänschen und Heiligen: Zur Trias von Manipulation, Liebe und Autonomie. Philosophie.ch. Swiss Portal for Philosophy, 25. Dezember 2017. https://www.philosophie.ch/philosophie/highlights/liebe-und-gemeinschaft/zwischen-gaenschen-und-heiligen. Zugegriffen: 07. Februar 2018.
Fischer, A. / Illies, C. (2018). Modulated Feelings: The Pleasurable-Ends-Model of Manipulation. Philosophical Inquiries 6 (2).
Gigerenzer, G. (2008). Rationality for Mortals. How People Cope with Unvertainty. Oxford, New York: Oxford University Press.
Glanton, D. (2017). Trump, the master manipulator, using anthem controversy to divide Americans. Chicago Tribune, 26. September 2017. http://www.chicagotribune.com/news/columnists/glanton/ct-trump-nfl-racism-dahleen-glanton-met-20170925-column.html. Zugegriffen: 06. Februar 2018.
Goodin, R. E. (1980). Manipulatory Politics. New Haven: Yale University Press.
Hacker, F. (1978). Freiheit, die sie meinen. Hamburg: Hoffmann & Campe.
Kaeser, E. (2016). Das postfaktische Zeitalter. Neue Zürcher Zeitung, 22. August 2016. https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/googeln-statt-wissen-das-postfaktische-zeitalter-ld.111900. Zugegriffen: 04. Februar 2018.
Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. München: Siedler Verlag.
Kuhlmann, W. (1994). Rhetorik und Ethik. In: W. Armbrecht / U. Zabel (Hrsg.): Normative Aspekte der Public Relations. Grundlegende Fragen und Perspektiven. Eine Einführung, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 35–50.
Laclau, E. (1996). Emancipation(s). London/New York: Verso.
Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London/New York: Verso.
Lindner, L. (2016). Respekt. In: D. Frey (Hrsg.): Psychologie der Werte. Von Achtsamkeit bis Zivilcourage. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 167–176.
Lippmann, W. (2008 [1922]). Public Opinion. Miami: BN Publishing.
Löwenthal, L. (1982). Falsche Propheten. Studien zum Autoritarismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Merten, K. (1994). Wirkungen von Kommunikation. In: K. Merten et al. (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 291–328.
Meyer, T. (2006). Populismus und die Medien. In: F. Decker (Hrsg.): Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv? Wiesbaden: VS – Verlag für Sozialwissenschaften, S. 81–98.
Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition 39 (4), 541–563. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x.
Müller, J.-W. (2016). Was ist Populismus. Ein Essay. Berlin: Suhrkamp.
Nietzsche, F. (1999). Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. In Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe, Bd. 1: Die Geburt der Tragödie, Unzeitgemäße Betrachtungen I-IV, Nachgelassene Schriften 1870–1873, hrsgg. v. G. Colli und M. Montinari, München: dtv, S. 871–890.
Noggle, R. (1996). Manipulative Actions: A Conceptual and Moral Analysis. American Philosophical Quarterly 33 (1), 43–55.
Novalis (1837). Fragmente vermischten Inhalts. In: Novalis Schriften, hrsgg. v. L. Tieck und F. Schlegel. Paris: Felix Locquin, S. 251–289.
Pörksen, B. (2017). Sind wir an alldem Schuld? Zeit-Online, 05. Februar 2017. http://www.zeit.de/2017/06/donald-trump-wladimir-putin-autoritaere-weltordnung-postmoderne. Zugegriffen: 06. Februar 2018.
Raz, J. (2001). Value, Respect, And Attachment. Cambridge: CUP.
Sennett, R. (2003). Respect. The Formation of Character in a World of Inequality. London: Allen Lane.
Seyd, B. C. (2012). Der Wahl-O-Mat und seine Grenzen. Über die schwierige Theoretisierung des Populismus. In: K. -M. Kodalle / J. Achatz (Hrsg.). Populismus. Unvermeidbares Element einer Demokratie? Würzburg: Königshausen & Neumann: S. 85–100.
Simon, H. A. (1979). Models of Thought. New Haven: Yale University Press.
Vietta, S. (2012). Rationalität – eine Weltgeschichte. Europäische Kulturgeschichte und Globalisierung. München: Wilhelm Fink.
Wehling, E. (2016). Politisches Framing. Wie eine Nation ihr Denken einredet – und daraus Politik wird. Köln: Herbert von Halem.
Wood, A. W. (2014). Coercion, Manipulation, Exploitation. In: C. Coons / M. Weber (Hrsg.). Manipulation. Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, S. 17–50.
Yuhas, A. (2017). Smoke and mirrors. How Trump manipulates the media and opponents. The Guardian, 18. Januar 2017. https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/18/donald-trump-media-manipulation-tactics. Zugegriffen: 06. Februar 2018.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2018 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Fischer, A. (2018). Ein Parasit im Kokon des Schmetterlings? Manipulation, Kommunikation und Ethik. In: Sachs-Hombach, K., Zywietz, B. (eds) Fake News, Hashtags & Social Bots. Aktivismus- und Propagandaforschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22118-8_2
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-22118-8_2
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-22117-1
Online ISBN: 978-3-658-22118-8
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)